Das heißt Frieden – die Grundsätze der EKD-Friedensdenkschrift
11. November 2025
Die EKD hat ihre Friedensdenkschrift veröffentlicht und auf ihrer jüngsten Synodentagung vorgestellt. Es ist ein Papier, das am christlichen Friedensideal festhält. Gleichwohl ringt es auch mit der politischen Verantwortung: Wann sind militärische Schritte ethisch vertretbar?
Wie stehen wir zu militärischen Hilfen, wenn eine Demokratie in Gefahr ist? Sind solche Hilfen im Verteidigungsfall vereinbar mit unseren Friedensbemühungen? Diese und ähnliche Frage beschäftigt Christ:innen seit Beginn des Krieges in der Ukraine.
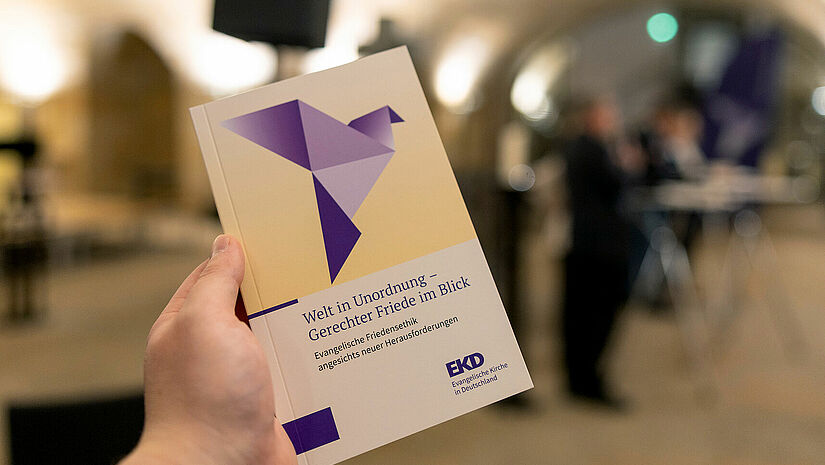
Als Reaktion darauf entstand die Friedensdenkschrift der EKD. Die Publikation ist auf der jüngsten Tagung der EKD-Synode veröffentlicht worden. Schon jetzt ist klar: "Die evangelische Friedensethik befindet sich in einem Prozess der Neuorientierung", wie es im Vorwort heißt.
Doch was heißt das konkret? Das sind die 10 Grundsätze in verkürzter Form:
1. Angesichts der Grausamkeit von Tod, Vergewaltigung, Verletzung und Traumatisierung durch bewaffnete Konflikte muss der Schutz vor Gewalt im Zentrum der Bemühungen von Politik, Zivilgesellschaft und Kirche stehen. Verteidigungsfähigkeit als Teil einer umfassenden Sicherheitspolitik erhält ihre Berechtigung, ihr Ziel und auch ihre Grenze aus der Friedenslogik.
2. Hybride Kriegsführung, digitale Desinformation und Cyber-Operationen fordern ein breites Verständnis von Sicherheit. Die Kirche ist in der Pflicht, zur Aufklärung beizutragen und gegen gesellschaftliche Polarisierung und (algorithmisch verstärkte) Radikalisierung Stellung zu beziehen.
3. Eine Politik der Angst schützt nicht vor Terrorismus, sie macht ihn nur stärker. Demgegenüber gilt es, das Verbindende zu stärken und den destruktiven Zielen eines Terrorismus jedweder Couleur entschieden entgegenzutreten.
4. Politisches Handeln muss einer Herrschaft des Rechts statt der Macht des Stärkeren dienen. Die evangelische Friedensethik steht klar für die Bindung politischen Handelns an das Recht und für eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik.
5. Klimagerechtigkeit ist integraler Bestandteil der Friedenspolitik.
6. Der Besitz und die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen widersprechen dem Geist des Gerechten Friedens. Ethisch ist die Ächtung von Atomwaffen aufgrund ihres verheerenden Potenzials geboten. Der Besitz von Nuklearwaffen kann aber angesichts der weltpolitischen Verteilung dieser Waffen trotzdem politisch notwendig sein. Dieses Dilemma kann im Moment nicht aufgelöst werden.
7. Es gibt – jenseits von Bündnisverpflichtungen – keine generelle ethische Pflicht zur Nothilfe durch Waffenlieferung, wohl aber die Notwendigkeit der Einzelfallabwägung.
8. Gemeinschaftliche Sicherheit braucht den Einzelnen. In der Frage einer allgemeinen Dienstpflicht – etwa in Form eines sozialen, zivilen Friedensdienstes oder eines alternativen Militärdiensts – regt die Denkschrift eine gesellschaftliche Debatte an.
9. Das Engagement für Friedensbildung und Friedensarbeit ist für Christinnen und Christen ein unverzichtbarer Beitrag zu einer friedensfähigen Gesellschaft. Die Friedensarbeit lädt dazu ein, die Friedensbotschaft des Evangeliums im Alltag zu leben und fördert gemeinsam mit der Friedensbildung Haltungen, die Gewalt überwinden helfen und Versöhnung ermöglichen – im Kleinen wie im Großen.
10. Die Kirche spricht von Hoffnung. Nicht als fertige Lösung, sondern als Einladung zum verantwortlichen Handeln.
Zusammengefasst geht es also um einen „gerechten Frieden“, der militärische Mittel nicht in jedem Fall ablehnt, sondern in Ausnahmefällen als notwendig ansieht, um Menschen eines Landes zu schützen. Dafür müssen vier Dimensionen erfüllt sein: der Schutz vor Gewalt, die Förderung von Freiheit, der Abbau von Ungleichheiten und ein friedensfördernder Umgang mit Pluralität.
Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg
Ein gerechter Frieden, so die EKD-Ratsvorsitzende, sei mehr als die Abwesenheit von Krieg. „Es bleibt ein Gebot der Nächstenliebe, dass wir Menschen, die an Leib, Leben und ihrer Würde bedroht sind, nicht schutzlos der Gewalt ausgesetzt lassen.“

Waffenlieferungen dürfen laut Denkschrift demnach nur dem Schutz der Bevölkerung und der Wiederherstellung des Friedens dienen. Ein besonderer Punkt ist das Dilemma der atomaren Drohung: So sind Atomwaffen aus friedensethischer Sicht weiterhin nicht zu rechtfertigen. Die Denkschrift erkennt aber an, dass ihr Besitz der Abschreckung dienen kann.
Mit dieser Denkschrift, so machte Fehrs klar, wolle die evangelische Kirche keine Politik betreiben. Vielmehr gehe es darum, Haltung zu zeigen. „Wir sind aus unserem Glauben heraus überzeugt, dass wir bestimmte Werte in dieser Gesellschaft halten müssen“, sagte die EKD-Ratsvorsitzende.

