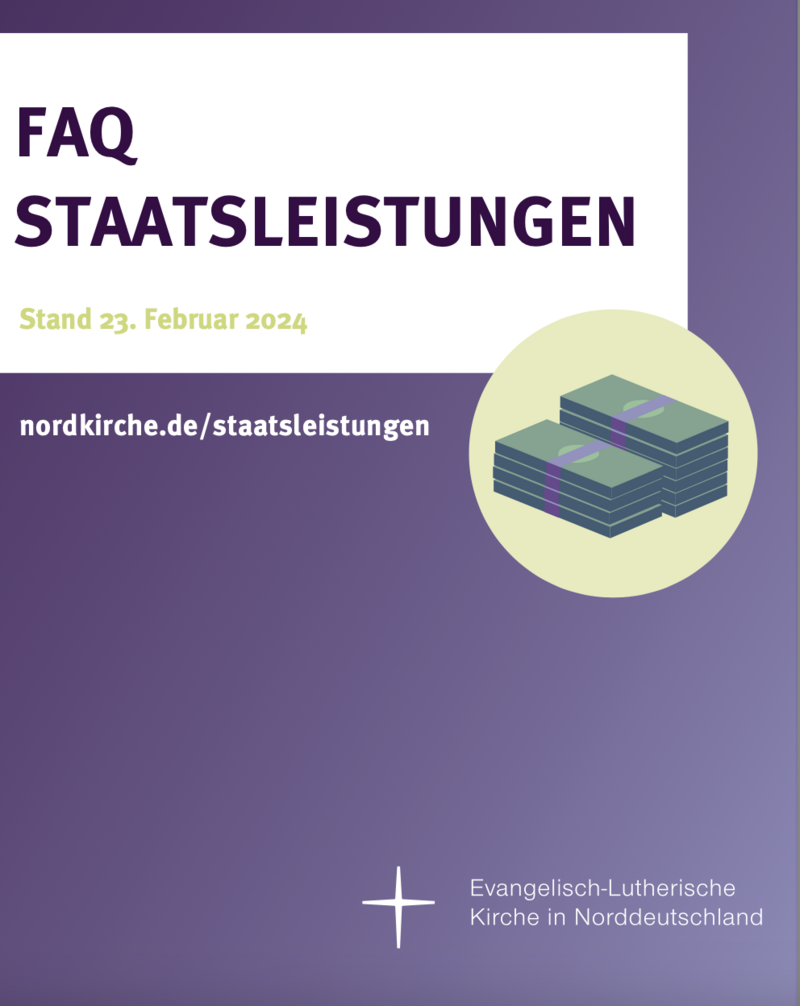Staatsleistungen
Definition und Ursprung
Staatsleistungen sind (1.) vermögenswerte Rechtspositionen, die (2.) auf Dauer angelegt sind und (3.) sachlich einen historischen Bezug zu säkularisationsbedingten Vermögensverlusten der Religionsgemeinschaften haben. Die großen Säkularisationswellen fanden im Zuge der Reformation, des Westfälischen Friedens und des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 statt. Letzterer wird häufig als maßgeblicher Grund für Staatsleistungen genannt, ist aber ganz überwiegend nur für die römisch-katholische Kirche relevant. Die Staatsleistungen für die evangelischen Kirchen beruhen zumeist auf Eigentumsübergängen im Zuge der Reformation.
In den 50er Jahren wurden in den westlichen Bundesländern mit den evangelischen Landeskirchen und in den östlichen Bundesländern in den 90er Jahren Staatskirchenverträge geschlossen, die das Verhältnis von Staat und Kirche in den jeweiligen Territorien regeln. Dabei sind die auf einer Vielzahl von alten Gesetzen, Verträgen etc. beruhenden Staatsleistungen kapitalisiert, pauschaliert und mit einer Dynamisierungsklausel versehen worden.
FAQ Staatsleistungen – Antworten auf Fragen
Was finanziert die Nordkirche mit Staatsleistungen? Und warum soll ein jahrhundertealter Anspruch der christlichen Kirchen in Deutschland auf finanzielle Entschädigung abgelöst werden? Alles Wissenswerte und viele weitere Fragen beantworten wir in unserer Broschüre
Weitere Info, Quellen und Links
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD):
ekd.de/staatsleistungen-antworten-auf-die-wichtigsten-fragen
Nordkirche:
Staatskirchenverträge und Verfahren der Ablösung im Gebiet der Nordkirche
Wie die meisten anderen Landeskirchen auch erhält die Nordkirche solche staatlichen Mittel. Mit rund 26 Millionen Euro stellen sie einen Anteil am Gesamthaushalt von etwa sechs Prozent (Stand 2013). Diese sind nicht etwa Subventionen, sondern historisch bedingte und vertraglich eindeutig geregelte Rechtsansprüche der Kirche gegen den Staat – hier insbesondere gegen die Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Diese so genannten Staatsleistungen
sind zumeist eine Entschädigung für erlittene Vermögensverluste der Kirchen oder ein Ausgleich für frühere Verpflichtungen. So hatte sich der Staat im Zuge der Säkularisation verpflichtet, Aufgaben der Kirche zu finanzieren. Allein der Staat Preußen hat zwischen 1919 und 1943 umgerechnet rund 3,5 Milliarden Euro an die evangelische Kirche geleistet. Das Land Schleswig-Holstein hat später diese Rechtsverpflichtung aufgegriffen und im Staatskirchenvertrag festgelegt. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich das Land nach dem Mauerfall ähnlich verhalten.
Im Grundgesetz (Art. 140) ist geregelt,
dass eine Ablösung solcher Leistungen erfolgen soll. Ablösung bedeutet Aufhebung gegen Entschädigung. Dies ist natürlich auch für die Nordkirche denkbar. Voraussetzung ist, dass das im Grundgesetz vorgeschriebene Verfahren eingehalten wird. Danach haben die Länder entsprechende Gesetze zu erlassen, die ihrerseits auf einer Grundsatzgesetzgebung des Bundes beruhen müssen. Das bedeutet auch: ohne Grundsatzgesetz des Bundes gibt es keine Ablösung durch die Länder!
Während es früher
eine große Anzahl einzelner Verpflichtungen des Staates – beispielsweise gegenüber Gemeinden – gab, bündeln heute Staatsverträge die historischen Ansprüche derKirchen. Sie haben ihren Ursprung u.a. in Enteignungen und früheren vertraglich geregelten Zusagen des Staates. Im Staatskirchenvertrag des Landes Schleswig-Holstein mit der evangelischen Kirche von 1957 sind insbesondere Zuwendungen für so genannte kirchenregimentliche Zwecke (Leitung bzw. Selbstverwaltung) sowie für Pfarrbesoldung und -versorgung geregelt. Heute liegen die Zahlungen des Landes Schleswig-Holstein bei rund zwölf Millionen Euro.
In Mecklenburg-Vorpommern
regelt der so genannte Güstrower Vertrag seit 1994 die Beziehungen zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der evangelischen Kirche. Die früher gewährten Dotationen für Kirchenleitungen, Pfarrbesoldung und -versorgung und kirchenregimentliche Zwecke des Landes sind in den vertraglich beschriebenen Staatsleistungen zusammengefasst worden, die jeweils als Gesamtzuschuss gezahlt werden. Zudem traten an die Stelle der bisherigen Ansprüche aus den staatlichen Baupatronaten und Baulasten pauschalierte Zahlungen. Diese Staatsleistungen gehen zunächst als Einnahme an Landeskirche, die diese über die Schlüsselzuweisungen an die Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern weiterreicht.
Von der Freien und Hansestadt Hamburg
erhält die Nordkirche keine Staatsleistungen, frühere Verpflichtungen sind in den 1960er und 1970er Jahren abgelöst worden. Der Kirchenkreis Hamburg-Ost erhält allerdings noch eine Zuweisung als Folge der Enteignung eines Klosters im Jahr 1875.